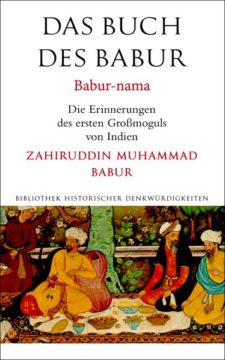Babur der Tiger: Eroberer, Mensch und Dichter
Konturen einer ungewöhnlichen Herrscherpersönlichkeit
Von Wolfgang Friedrich Stammler
Das Erbe eines Stammbaums, in dem Dschingis Khan und Timur figurierten, setzte sich gegen widrige Lebensumstände durch: Trotz Rückschlägen erweiterte Zahiruddin Muhammad, auch Babur genannt, sein Herrschaftsgebiet und wurde zum Gründer des Mogulreiches. Doch über dem Schwert hat er die Feder nicht vernachlässigt.
Ich habe die Kunde vernommen, einst habe Jamschid der Schöne
Solches auf einem Stein am Rand eines Sprungquells verfasst:
«Zu Vielen haben wir einst die Luft dieser Quelle geatmet
Und wurden im Augenblick drauf plötzlich vom Tod überrascht.
Mit Tapferkeit und mit Mut haben die Welt wir erobert,
Aber wir haben sie nicht mitgenommen ins Grab.»
Achtzehn Jahre alt ist der Verfasser dieser Zeilen, als er sie in den Bergen östlich von Samarkand in eine Felswand ritzt. Wieder einmal, wie so oft in seinem jungen Leben, befindet er sich auf der Flucht, und wieder ist es sein hartnäckigster Widersacher, der Usbeken-Khan Schaybani, der ihm die Erfüllung seines Traumes verwehrt: die Er-oberung Samarkands, Hauptstadt und Inbegriff des Timuriden-Reiches. Wie tröstlich deshalb, sich in solch misslicher Lage Jamschids, dieses Helden aus der persischen Mythologie, zu erinnern und – gleichsam als Anrufung und Beschwörung zugleich – sein eigenes mit dessen Schicksal zu messen.
Doch was in solcher Lage vermessen klingt, sollte sich knapp dreissig Jahre später als Prophetie erweisen. Am Ende eines an Niederlagen, Demütigungen und Verzweiflung reichen Lebens hat sich des Dichters Traum auf eine höchst dramatische und keineswegs vorhersehbare Weise erfüllt. Hatte er sich doch, allen Widrigkeiten zum Trotz, mit Tapferkeit und Mut eine Welt erobert und die Grundlage für ein Reich geschaffen, dessen Glanz und Grösse nach ihm sogar zum Mythos werden sollte. Als er knapp 48-jährig starb, stand sein Name für einen der ruhmvollsten und denkwür-digsten Herrscher Asiens: Zahiruddin Muhammad, auch Babur der Tiger genannt, der Begründer der Moguldynastie und erster Grossmogul von Indien (1483-1530).
Die Geschichte kennt Babur als Begründer eines Reiches, das zu den glanzvollsten und kulturell bedeutendsten in der Galerie der grossen Imperien zählt und im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts als ein Wunder der Schöpfung, als Inbegriff des Mär-chenreiches galt. Dass dieser Herrscher daneben auch ein begnadeter Dichter und Verfasser eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur war, des «Babur-nama» oder «Vaqiat-i Baburi» (Das Buch der Ereignisse des Babur), ist dagegen – vor allem im deutschsprachigen Raum – nur wenigen bekannt.
VERSCHMÄHTES LITERARISCHES ERBE
Dies ist umso erstaunlicher, als dieses Werk in allen wichtigen literatur- und ge-schichtswissenschaftlichen Darstellungen auf einhellige Bewunderung und Sympathie stösst und, wie etwa in Kindlers Literaturlexikon, als «eines der inhaltsreichsten und schönsten Prosawerke, ja als das lebendigste der ganzen türkischen Literatur» bezeichnet wird. In so märchenhaften Glanz auch die Vorstellung von der Grösse und Pracht des Mogulreiches getaucht ist, wie phantastisch auch die Schilderungen von Reisenden aus der damaligen Zeit anmuten und zu wie vielen Romanen und Filmen das alte Indien auch den Stoff geliefert hat – der ungewöhnliche literarische Nachlass seines Begründers blieb von diesem Interesse weitgehend ausgespart. Daran vermochte auch die 1988 im Manesse-Verlag erschienene, inzwischen jedoch vergriffene deutsche Ausgabe dieses Werkes nur wenig zu ändern.
Erstaunlich ist diese Vernachlässigung auch deshalb, weil es sich bei Babur keineswegs um einen unbedeutenden Herrscher handelt, vielmehr um einen der wenigen Grossen der Geschichte – gross im Sinne Henry de Montherlants, der Recht hat, wenn er beklagt, dass man nur allzu oft Grösse mit Berühmtheit verwechselt. Berühmtheit hat Babur nicht erlangt, vergleicht man ihn etwa mit Cäsar, Dschingis Khan oder Napoleon; und doch war er ein Grosser, insofern er die Orientierung für sein Denken und Handeln in geradezu alttestamentarisch anmutender Weise stets aus religiös geprägten ethisch-moralischen Begriffen bezog und zu allen Zeiten selbstkritisch reflektiert hatte. Babur selbst hatte einen ausgeprägten Sinn für Grösse. Der Massstab, den er bei sich und anderen dafür anlegte, war nicht nur die Zahl der gewonnenen Schlachten und eroberten Länder; vielmehr galten ihm Bildung und Tugend, Wahrhaftigkeit und Treue, Menschlichkeit und Würde, die einer in seinem Leben bewies, als wichtigste Eigenschaften für einen Herrscher – Eigenschaften, in deren Mangel er nicht zuletzt den Grund für den Verfall des Timuriden-Hauses in Herat sah.
Selbstverklärung und Selbstrechtfertigung waren ihm fremd. So schreibt er einmal: «In dieser Chronik der Ereignisse halte ich streng darauf, in allem die Wahrheit zu sagen und über jede Tat so zu berichten, wie sie geschah. In diesem Sinne habe ich notwendigerweise sowohl von den guten als auch den schlechten Taten meiner Väter und Brüder gesprochen und von den Stärken und Schwächen berichtet, ob von An-gehörigen meiner Familie oder von Fremden», und – so muss man hinzufügen – auch seinen eigenen. Was die Begegnung mit Babur so eindrücklich macht, ist die unge-künstelte Vornehmheit seines Wesens, der Verzicht auf jegliche Herrscherallüre, seine – nicht nur für einen orientalischen Herrscher – ungewöhnliche Spontaneität und Direktheit und sein hohes Mass an Selbstreflexion. So abenteuerlich sich seine Erin-nerungen auch lesen, sie sind vor allem ein in ihrer Offenheit und Ehrlichkeit einzig-artiges Zeugnis der inneren Brüche und Widersprüche eines Menschen auf seinem Weg zur Herrschaft, ein dokumentarischer Entwicklungs- und Erziehungsroman und – dies wohl auch eines der Motive für ihre Niederschrift – ein politisches Testament an seine Nachkommenschaft, die dies auch erkannt und ihm in wunderbaren illuminierten Übersetzungen und Handschriften ein die ganze 330-jährige Dynastie überdauerndes Denkmal geschaffen hat.
Worin aber bestand die historische Leistung dieses Mannes, und warum geniesst er heute wieder in den Ländern Mittelasiens – Usbekistan, Afghanistan und Indien – eine so grosse Verehrung? Vor allem deshalb, weil sich mit seiner Person der Beginn einer neuen Epoche des indischen Subkontinents verbindet. Ihm gelang, was bis dahin noch kein Herrscher vor ihm erreicht hatte: die Einigung Afghanistans zu einem starken Königreich, stark genug, um als Ausgangsbasis für die gewaltigste Unternehmung zu dienen: die Eroberung Indiens. Durch Babur eröffnete sich für das damals politisch und kulturell darniederliegende Indien die Chance zu einer machtvollen Erneuerung, die später von seinem Sohn Humayun und seinem Enkel Akbar ergriffen wurde. Unter Akbar vor allem «nahm der alte Traum eines geeinten Indien, das nicht nur politisch zu einem Staat vereinigt, sondern auch organisch zu einem Volk verschmolzen war, neue Gestalt an» (Jawaharlal Nehru). Den Weg dazu aber bereitete Babur, und es ist nicht nur diese historische Leistung, die ihn mit Cäsar verbindet, der sechzehnhundert Jahre zuvor die Grundlage für das römische Weltreich geschaffen hatte.
FRÜHE FEHLSCHLÄGE
Dabei hatte sein Leben eher bescheiden begonnen. Man schrieb den 14. Februar 1483, das Jahr, in dem in Deutschland Martin Luther geboren wurde, als Babur das Licht der kleinen Welt von Farghana im heutigen Usbekistan erblickte. Die Aussichten auf ein stolzes Erbe waren nicht gross. Das kleine Fürstentum, kaum dreimal so gross wie das heutige Fürstentum Liechtenstein, hatte zu dieser Zeit unter den Einfällen der Mongolen und Usbeken zu leiden, und die durch Nachfolgestreitigkeiten geschwächte Herrschaft der Zentralmacht in Samarkand verhiess keine gesicherte Zukunft für das Land. Umso schwerer wog angesichts dieser Umstände ein anderes Erbe: Baburs Abstammung mütterlicherseits vom Mongolenherrscher Dschingis Khan (1155-1227) und väterlicherseits von Timur (1336-1405), dem durch seine Grausamkeit berüchtigten Herrscher eines von Indien über Persien bis Syrien reichenden Grossreiches mit der Hauptstadt Samarkand, der glanzvollen Metropole Mittelasiens. Dieser Stadt galt seine Sehnsucht, und sie bewegte schon früh seine Eroberungsphan-tasien. Die Gelegenheit, diese zu verwirklichen, sollte nicht lange auf sich warten lassen.
«Im Alter von zwölf Jahren wurde ich König im Lande Farghana. Dies war im Mo-nat Ramadan des Jahres 899.» Mit diesen Worten beginnt Babur seine Erinnerungen. Es ist – nach christlicher Zeitrechnung – der Juni 1494. Kurz zuvor war sein zur Fresslust und Fülle neigender Vater beim Taubenfüttern in den Tod gestürzt, weil der Balkon, auf dem er stand, unter seinem Gewicht zusammenbrach. Als sechs Monate später durch den Tod des letzten Herrschers von Samarkand der Timuriden-Thron verwaist und dadurch die Nachfolgefrage offen war, nimmt Babur dies zum willkommenen Anlass, seine Ansprüche geltend zu machen. Kaum vierzehn geworden, zieht er zum ersten Mal gegen Samarkand – doch vergeblich, denn am Ende einer mehrmonatigen Belagerung muss er unverrichteter Dinge wieder abziehen. Als er dann auch noch seine Heimatstadt Andijan verliert, schreibt er: «Ich befand mich nun in einer sehr traurigen Lage und konnte es nicht hindern, dass ich viele Tränen vergoss. Da ich mich aber nun einmal zum Herrscher und Eroberer berufen fühlte, konnte ich auch nicht wie ein einfacher Zuschauer still sitzen bleiben, nur weil ich einmal bei meinen Unternehmungen nicht erfolgreich war.»
In den nächsten Jahren unternimmt er immer wieder neue Feldzüge, auch gegen Samarkand, das lange sein wichtigstes Ziel bleibt, sammelt Verbündete, kann sich auch zweimal in der Stadt behaupten, doch nur für kurze Zeit: Krankheit, Verrat und mächtigere Rivalen verhindern einen dauerhaften Erfolg. Keiner seiner Versuche, sich in seinem Stammland zu behaupten und den allmählichen Zerfall des Timuriden-Reiches aufzuhalten, hat Bestand. Je mehr er versucht, das Schicksal zu zwingen, desto weniger gelingt es ihm. Am Ende seiner Jugendjahre hat er alles verloren. Als Flüchtling irrt er mit einer Handvoll Getreuen durch die Berge. «Damals», so erinnert er sich, «dachte ich: Wie lange noch muss ich so gequält von Verzweiflung in diesem Land Farghana umherirren? Es wird Zeit, dass ich mich auf die Suche nach einem Königreich mache. So bestieg ich mein Pferd und verliess Farghana.»
REBELLISCHES AFGHANISTAN
Sein Weg führt ihn nach Süden. Dort, hinter der steilen Barriere des Hindukusch, lockt ihn Kabul. Zuvor aber muss der Jüngling noch eine andere Probe bestehen: den Gebrauch des Rasiermessers, in der Tradition der Mongolen der entscheidende und mit einem grossen Fest gefeierte Schritt ins Erwachsenenalter. Von nun an beginnt sich sein Schicksal zu wenden. Im September 1504 gelingt ihm im Handstreich und, wie er betont, ohne Kampf und Blutvergiessen die Eroberung Kabuls.
Dieser Stadt und ihrem Umland gehört fortan Baburs grosse Liebe. Mit einer Neu-gier, wie man sie sonst nur bei Forschungsreisenden der Neuzeit kennt, erkundet er auf zahlreichen Exkursionen das Land, studiert seine geographische Lage, die Art der Besiedlung und deren Verteilung, die Verkehrswege und Pässe, seine Flora und Fauna, die Sitten und Gebräuche der Menschen, ihre Sprachen und Dialekte, ihre wirt-schaftlichen Verhältnisse sowie deren Erträge.
Bald aber lernt Babur auch die andere Seite des Landes kennen: den Widerstand der kriegerischen Bergstämme. Diese weigern sich, Tribut zu entrichten. Sofort bricht er zu einem Feldzug gegen sie auf – doch vergeblich. Als sein Angriff misslingt, wird ihm klar: «Dieses Land kann nur mit dem Säbel, nicht aber mit der Feder regiert werden.» Von nun an geht er mit noch grösserer Härte gegen die Bevölkerung vor und lässt, wie sein grausamer Vorfahr Timur, zur Abschreckung aus den abgeschlagenen Köpfen der Afghanen Schädelpyramiden errichten.
Nach zahlreichen Kämpfen gelingt ihm die Befriedung des Landes. Seine Herrschaft scheint gesichert, und so befiehlt er nach dem Tod des letzten Timuriden-Herrschers, Husayn Bayqara, in Herat, dass man ihn «von nun an als Padischah [Kaiser] anrede» (1507). Endlich hat er sein Ziel, ein Königreich zu erwerben, erreicht, und als ihm bald darauf der ersehnte Sohn geboren wird, sein späterer Nachfolger Humayun (1508-1556), hätte er es eigentlich genug sein lassen können. Doch der Eroberer in ihm lässt ihn nicht ruhen; von nun an hält er es mit dem Sprichwort: «Wenn ein frommer Mann die Hälfte seines Brotes isst, gibt er die andere den Derwischen. Wenn ein König aber ein Land erobert, wird er danach immer von der Eroberung eines weiteren träumen.»
Noch einmal, 1511, versucht er, sich den Traum einer Herrschaft in Samarkand zu erfüllen, diesmal sogar um den Preis der Vasallenschaft unter der Oberhoheit des mächtigen schiitischen Herrschers Schah Ismail. Als er dafür jedoch auch noch bereit ist, seinem sunnitischen Glauben abzuschwören, und in Samarkand das Freitagsgebet im Namen der zwölf schiitischen Imame verlesen lässt, bedeutet dies das Ende seines Traums: Was achtzig Jahre nach ihm dem Hugenotten Henri IV die französische Krone sichern sollte («Paris ist eine Messe wert»), wird Babur zum Verhängnis. Die sunnitische Bevölkerung kündigt ihm die Gefolgschaft auf, und so muss Babur nach nur achtmonatiger Herrschaft die Stadt wieder verlassen.
DER HERRSCHER ALS AUTOR
Die folgenden Jahre verbringt Babur mit Raubzügen und ausschweifenden Festgelagen. Neben dem Wein, den er lange Zeit gemieden hat, entdeckt er vor allem die be-rauschende Wirkung des Majun, eines opiumhaltigen Gebäcks, das ihn fortan als täg-liche Droge begleitet. Und mehr noch: Hier endlich findet er die Musse, wieder an-zuknüpfen an seine frühen Versuche als Dichter – gehört doch die Beschäftigung mit der Dichtkunst nach Baburs Verständnis zu den wesentlichen Merkmalen eines guten Herrschers. So ist es für ihn nicht nur selbstverständlich, stets einen Kreis von Dichtern und Künstlern um sich zu scharen, sondern auch, selbst zu dichten.
Begonnen hat er damit bereits als 17-Jähriger, als ihn, wie er schreibt, «eine bis dahin noch nie gefühlte Leidenschaft für einen anderen Menschen ergriffen hatte»:
Niemand ist verliebter noch als ich, zerstörter und verachtet;
Kein Geliebter mitleidsloser noch als du und quälender.
In diesen Versen kündigt sich an, welches die Motive seines Schreibens sein werden: seine Gefühle, Bedrängnisse, Leidenschaften. Zwei Jahre später, 1502, während einsamer und demütigender Tage bei seinem Onkel in Taschkent, fasst er seinen Zu-stand in die Verse: Kein treuern Freund als meine Seele hab ich je gefunden / Keinem verschwiegneren als meinem Herz mich je verbunden, und schreibt: «Diese kleine Ode umfasste sechs Reimpaare. Später schrieb ich alle meine kleinen Oden, die ich verfasste, in dieser Anordnung.»
Viele weitere sollten noch folgen. Die meisten während der 22 Jahre, die er in Af-ghanistan verbringt. Am Ende werden es über 400 Gedichte, die er zu einem zu seiner Zeit viel beachteten Diwan zusammenfasst. Eines seiner schönsten Gedichte notiert er einmal während eines Ausflugs in das Hochland von Gül-i-Bahar (Blüte des Frühlings):
Mein Herz, ach es gleicht einer Knospe der Rose, der roten,
Verschlossen ruht seine Flamme wie in der Knospe die Blüte.
Wäre auch tausendmal Frühling und hauchte es an,
Wie sollte je mein Herz zur Rose erblühn?
Auch der Beginn der Niederschrift seiner Erinnerungen fällt in diese Zeit. Doch anders als seine Gedichte und sein heute noch geschätztes «Aruz risalasi», ein Werk über türkische Metrik, hat er seine Erinnerungen wohl kaum für eine breitere Öffentlichkeit bestimmt. Vielmehr ist anzunehmen, dass er sie, wie bereits angedeutet, als Sittenspiegel und «Schule des Herrschers» für seine Nachkommen geschrieben hat, als exemplarisches Zeugnis dafür, welchen Anfechtungen und Gefährdungen ein Mensch, der Grosses erstreben will, ausgesetzt ist – und wohin es führt, wenn er diesen erliegt.
Dass gerade dieses Werk seinen literarischen Ruhm begründen sollte, wirkt daher fast wie eine Ironie der Geschichte. Die Gründe dafür liegen zum einen in der gelungenen Adaption seines Inhalts durch seine Nachfolger, zum anderen in der für seine Zeit ungewöhnlichen Offenheit und Direktheit, mit der Babur sich darin zu seinen Fehlern und Schwächen bekennt. Vor allem aber ist es die Vielseitigkeit seiner Interessen, mit der er den Leser verblüfft, belehrt und dabei nicht selten auf spannende Art unterhält. Manches an ihm erinnert an Herodot, manches auch, was Babur so liebenswert macht, an die biblische Gestalt des David und dessen Sohn Salomo – eine Konstellation, die sich beinah auch auf Babur und seinen Enkel Akbar übertragen liesse.
NÜCHTERN UND EHRLICH
In Bann schlägt besonders die nüchterne Klarheit und Ungekünsteltheit von Baburs Sprache, wenngleich sie in ihrer unorientalischen Sprödigkeit bisweilen befremdend wirkt. Doch je mehr man sie auf sich einwirken lässt und je weiter man sich in sie hineinliest, desto wohltuender empfindet man diese Knappheit, und desto mehr er-schliessen sich einem die ihr innewohnende Bildkraft und Anmut. Nicht zuletzt ist sie es auch, die die Glaubwürdigkeit des Verfassers verbürgt. Er beschönigt nicht, sucht nicht nach gewählten oder gezierten Worten. Manieriertheit ist ihm verhasst, und wo er sie bei anderen entdeckt, weist er diese streng zurecht. So tadelt er einmal seinen Sohn Humayun: «Du hast mir geschrieben, weil ich dich darum gebeten habe, aber du hast deinen Brief nicht durchgelesen. Denn wenn du es getan hättest, hättest du sicher einige Änderungen angebracht. Er ist nicht nur schwierig zu lesen, er ist auch äusserst schwer verständlich – und wer hat je gerne ein Rätsel in Prosa gelesen? Gewiss ist dein seltsamer Wortgebrauch Ausdruck deiner gekünstelten Haltung. Von nun an schreibe ungekünstelt und in einfachen und klaren Worten. Du und der Leser werden künftig umso weniger Mühe haben.» Als Babur diese Zeilen schreibt, nennt er sich bereits Herrscher von Indien. Mit der Eroberung dieses reichen, ein Jahrhundert zuvor schon einmal von seinem Vorfahren Timur eroberten und geplünderten Landes erfüllt sich der Traum seines Lebens, Begründer eines neuen, des indischen Timuriden-Hauses zu werden.
Doch viel Zeit bleibt ihm nicht, den Reichtum zu geniessen. Immer stärker sehnt sich der 46-Jährige in sein geliebtes Kabul zurück. Das Klima macht ihm zu schaffen, auch einem Giftanschlag entgeht er nur mit knapper Not. Als dann auch noch sein Sohn Humayun an einem schweren Fieber erkrankt und die Ärzte nur den Rat wissen, etwas sehr Wertvolles zu opfern, damit Gott ihm Kraft und Gesundheit gewähre, «da kam mir in den Sinn, dass Humayun in der Welt doch nichts Kostbareres besässe als mich und dass ich mich folglich selbst opfern müsse. Ich begab mich also in sein Gemach, ging dreimal um seine Liegestatt und sagte: ‹Was auch immer dein Leid sein mag, ich nehme es auf mich.› Im selben Augenblick ergriff mich eine seltsame Schwere, während Humayun sich zusehends erholte. Ich aber fühlte Unwohlsein in mir auf-steigen und stürzte zu Boden.»
Wenig später, am 26. Dezember 1530, stirbt Babur. Noch einmal sollte sich, wie in dem eingangs zitierten Gedicht, gleichsam im Akt einer self-fulfilling prophecy, erfüllen, was er sich in einem drei Jahre zuvor verfassten Gedicht noch selbst verordnet hat. Auch diesmal ist sein Thema die Vanitas des Lebens, doch anders nun als dreissig Jahre zuvor. Jetzt galt es, angesichts der Ahnung nahen Ruhms, sich dessen über das Grab hinaus zu versichern:
Jeder, der geboren wird, muss sterben.
Nur Gott allein währt immerdar und ewig.
Besser ist darum, mit Ruhm bedeckt zu sterben
Als mit entehrtem Namen leben.
- Veröffentlicht am Sonntag 13. April 2025 von Alcorde Verlag
- ISBN: 9783939973645
- 600 Seiten
- Genre: Autobiographien, Biographien, Geschichte, Sachbücher