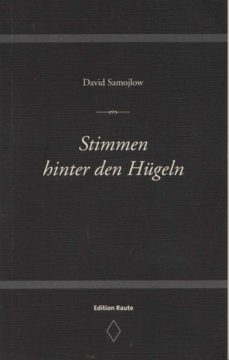Das Geburts- und das Sterbejahr (1920 bzw. 1990) des russischen
Dichters David Samojlow (eigentlich David Samujlowitsch Kaufman)
fallen ziemlich genau mit Beginn und Ende der Sowjetunion
zusammen, trotzdem wäre für ihn die Bezeichnung „sowjetischer
Dichter“ ebenso falsch wie diejenige „jüdischer Dichter russischer
Sprache“. Samojlow ist seinem ganzen Wesen nach Russe, seine
Heimat ist neben der Weite der russischen Landschaft vor allem
die russische Sprache, denn dass ihm, der zeitlebens von einer tiefen
humanitären Gesinnung geprägt war (wovon sein Werk vielfach
Zeugnis ablegt), die Sowjetunion keine Heimat sein konnte,
ist ebenso verständlich wie seine Entscheidung, nicht nach Israel
auszuwandern, als sich ihm in den siebziger Jahren die Möglichkeit
geboten hat. Samojlow ist den Weg der inneren Emigration
gegangen, den Weg der Heimatlosigkeit in einer Heimat, die er, je
geknechteter sie war, umso inniger liebte. Und damit teilt er das
Schicksal vieler, unzähliger, ja von Millionen Russen.
Es ist denn auch kein Zufall, dass ein anderer „Urrusse“, Alexander
Solschenizyn, der Russland nur unter Zwang verließ, sich
mit dem Dichter und Menschen intensiv beschäftigt und ihm im
Jahre 2003 in der Zeitschrift „Nowij mir“ einen ausführlichen
Aufsatz gewidmet hat. Diesem Umstand sind einige der nachfolgenden
Gedanken und Zitate zu verdanken.
David Samojlow wurde in Moskau geboren; 1938 begann er
ein Studium an der Philosophischen Fakultät. 1941 wurde er als
gemeiner Soldat eingezogen, 1942 erlitt er eine Verwundung: im Krieg, der tiefe seelische Wunden hinterließ, die bestimmt einer
der Gründe für seine pessimistische Geisteshaltung waren, hat er
u.a. auch als Mitarbeiter einer Garnisonszeitung gearbeitet. Bereits
früh begann er Gedichte zu schreiben, veröffentlichte aber
während Jahren nur Übersetzungen, vorwiegend aus dem Tschechischen
und Polnischen.1956 konnte er einen ersten Gedichtband
drucken lassen, der Gedichte aus zwei Jahrzehnten enthielt.
In ihnen zeigt sich, nach anfänglichem Experimentieren, jene klassische
Grundhaltung, die sein ganzes lyrisches Werk kennzeichnen
wird. Samojlows Vers ist aber nur vordergründig klassisch, seine
Modernität betrifft eine Art (jüdischen) Schalk, eine (auch inhaltliche)
Vertracktheit, die sich u.a. in seinen ungewöhnlichen
unreinen Reimen ausdrückt, welche Ausdruck eines enorm entwickelten
Lautempfindens sind. Gelegentlich zeigt sich dieses
schalkhafte Spiel mit den klassischen Formen auch in einer Art
metrischer „Zerrupftheit“, wie Alexander Solschenyzin schreibt;
d.h. die Versakzente hüpfen gerne aus dem Rahmen und geben
dem doch meist klaren Metrum eine unverhoffte Lebendigkeit, eine
Art ironische Verzerrtheit. Wären Samojlows Verse avantgardistischer
gewesen, hätte er zu Lebzeiten im Ausland bestimmt einen
größeren Bekanntheitsgrad erreicht. Aber auch seine bescheidene,
stille Haltung, seine Scheu vor dem Rampenlicht, seine zurückhaltende,
ganz in sich gekehrte Art waren schuld daran, dass er
nicht stärker wahrgenommen wurde. Samojlow hat nie viel Aufsehen
um seine Person gemacht. Seine spätere Berühmtheit und
eine gewisse Popularität in Russland verdankt er seinen Landsleuten
und Leidensgenossen, die das Unaussprechliche in den Erfahrungen
der meisten Russen, welche im „verfluchten 20. Jahrhundert“
lebten, in seinen kurzen, eher unprätentiösen Gedichten aufund
nachgespürt haben:
Wie ein Espenblatt leicht
Legt sich der Herbst
Mir auf die Schulter …
Allein, das ist später.
Die Grafik der Landschaft,
Die schwarzen Linien
In der leeren Luft …
Allein, das ist später.
Was war nur am Anfang?
Trauer, unsägliche Trauer
Trat mir ins Haus …
Nein! Das ist später.
Ein nachhaltiges, enigmatisches, unpolitisches Gedicht: Trauer, die
keinen Anfang und kein Ende hat, aber doch einen Anfang hatte,
nur wann? – da sich nur Trauer an Trauer reiht … Aber könnte
dies nicht auch ein gesellschafspolitisches Gedicht sein, nicht zuletzt,
da es ihm gelingt, von so vielen Lesern, von einer ganzen
Gesellschaft verinnerlicht zu werden? Denn der Autor schreibt da
einmal pointiert: „Der russische Vers ist nichts als bürgerliches Bewusstsein“,
wobei der unübersetzbare Terminus grazhdanstwennost
mehr als nur bürgerliches, gesellschaftliches, staatliches Bewusstsein
(oder auch Zivilcourage) bedeutet. Solschenizyn glaubt, Samojlow
habe es „geflissentlich vermieden“ diesem Grundsatz
nachzuleben, bzw. nachzuschreiben. Ich würde dies vorsichtiger
formulieren: Sogar Solschenizyn kann manchen Grund anführen,
der den Lyriker entlastet. Der wichtigste ist bestimmt Samojlows
introvertiertes, schwermütiges Naturell, das seine Gedichte zu ei ner „Lyrik fast auswegloser, kompakte Einsamkeit“ werden lässt.
Gedanken über das Ich, über die Natur überwiegen in seiner Lyrik,
man spürt die Schwierigkeit, zensurfähige Themen zu finden; er
weicht aus, in die Vergangenheit, in Wortspielereien; Samojlows
Gedichten spürt man oft an, dass sie ihm, dem nicht immer inspirierten
Autor, Mühe bereitet haben, was Solschenyzin dazu führt,
vom „Stempel einer künstlichen Konstruiertheit“ zu sprechen, den
eine ganze Reihe von Gedichten aufgedrückt bekommen habe. In
einer 1995 erschienenen Tagebuchaufzeichnung aus den siebziger
Jahren liest man denn auch: „Mühsam schleppe ich Verse durch
mein ganzes Leben, dränge sie gleichsam durch ein Nadelöhr,
und wenn ich sie einmal durchgedrängt habe, bin ich erschöpft
und verliere jedes Interesse an ihnen. Die verausgabte Kraft ist
der Vollkommenheit nicht zuträglich.“ Vielleicht ist es aber gerade
dieselbe unsägliche Mühe des Autors, die immer wieder kleine,
vollendete Meisterwerke hervorbringt, Juwele von bestürzender,
zauberhafter Tiefe, lakonische, besonnene, ehrliche, fast kindlich
intonierte Gedichte.
Aber nicht nur Klagen über die schöpferische Unlust, sondern
auch Klagen über finanzielle, häusliche, familiäre Sorgen, Wohnungsprobleme,
über die nicht zu unterschätzende Sorge, als vergleichsweise
unabhängiger, jüdischer, von der Sowjetmacht gerade
noch geduldeter Dichter zu überleben, häufen sich in seinen Tagebüchern
und finden sich – indirekt – auch in vielen Gedichten.
So ist es denn auch verständlich, dass er es Solschenizyn nicht
verzeihen will, wenn dieser (d.h. eine Figur aus der Krebsstation )
behauptet, den (sowjetischen) Dichtern gehe es finanziell zu gut.
„Was haben Sie nur gegen uns?“, meinte er 1971 bei einem Treffen
mit dem Dissidenten. Daraus wird ersichtlich, dass er sich doch
irgendwie mit dem ungeliebten Staat identifiziert, seine Kollegen zu verteidigen sucht, da er eben ihre äußerst schwierige Situation
aus eigener Erfahrung kennt und sich mit ihnen solidarisch fühlt.
Nun, er hält sich mit öffentlichen Äußerungen zurück, hat an den
Kongressen des Schriftstellerverbandes nicht teilgenommen und
auch nie öffentliche Ämter bekleidet, was für einen in der Sowjetunion
doch recht populären Dichter etwas heißen will. Zeitweise
verkehrt er mit Andrej Sacharow, hat aber auch Angst, dass man
ihm deswegen „seine Stadtwohnung wegnimmt“. Dieses ständige
Sich-Ducken-Müssen, dieses Lavieren, dieses Nicht-Wissen-woran-
man-ist hat ihn sicher jahrzehntelang zermürbt, bis er endlich
im Haus der Schriftsteller in Moskau eine Wohnung bekam. Aber
dann waren es die Altersbeschwerden, Familienzwiste, Sehprobleme,
die seinen Alltag beherrschten. Und auch eine Art moralische
oder „sittliche“ Depression, wie er sie nennt, d.h. traurig zu
sein über all die Lügen, die unvermeidlich waren, um in einem
totalitären Staat zu überleben, vieles zu spät erkannt zu haben:
„Neige dein Ohr nicht voller Vertrauen / jenen, die zu spät sehend
werden“, heißt es in einem Gedicht von 1974; und in einem Gedicht
aus den frühen achtziger Jahren will er für seine Lügen Abbitte
leisten:
Allein, dass ich die Lüge
Im Leben nicht vermied,
Dafür lass, Gott, mich bü.en,
Bestraf mich, Gott, dafür!
Unter diesen späten Gedichten, die in den Bänden „Stimmen
hinter den Hügeln“ (1985) und „Die hohle Hand“ (1987) vereint
wurden, finden sich viele, die zu seinen besten gehören. Sie
sind im Allgemeinen weniger gequält als die früheren, sie fließen irgendwie leichter, als hätte der Autor aufgehört zu kämpfen, als
atme er gelöster, freier. Reines Naturerleben und unverkrampfte
Ironie wechseln sich ab. Es ist nicht notwendig zu wissen, dass das
Leben nichtig ist, die Hauptsache ist, es im Augenblick zu leben,
flüchtig und geheimnisvoll, wie es eben ist:
Zu wissen, dass das Leben nichtig,
Kann nicht der Sinn des Lebens sein,
Ist doch mein Leben jetzt so flüchtig,
So augenblicklich, so geheim! …
Das Ende: Einswerden mit der Natur, sich in ihr auflösen, verstummen,
sorglos zerstieben:
Ein kleiner Vogel sang
In der silbernen Morgenröte,
So vernünftig und traurig
Wie eine frierende Seele.
Die Sonne ging auf. Der Vogel
Verstummte. Es spielte
Der Wind. Und ein Löwenzahn
Trocknete sich und zerstob sorglos.
C h r i s t o p h F e r b e r
- Veröffentlicht am Sonntag 28. Februar 2010 von Buchlabor
- ISBN: 9783929693942
- 56 Seiten
- Genre: Belletristik, Lyrik