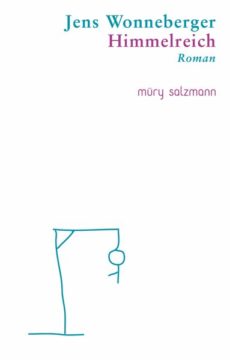Robert, ein Mann um die dreißig, kehrt ins Dorf seiner Kindheit zurück, „irgendwo am Schienenstrang zwischen Neustadt und Himmelreich“.
Die Mutter ist schon eine Weile tot, nun begraben sie Rudi, den Vater. Der war ein verschlossener Mann, dessen Vater einst nicht aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt und für den Jungen ein Fremder geblieben war. Und Fremdheit und Schweigen sind auch, die Roberts Beziehung zu diesem Vater geprägt haben. Das Beredtste, was dem Sohn von Rudi bleibt, ist die Bastelarbeit auf dem Dachboden: das Dorf in Miniaturformat, mit der Eisenbahn, die in der Wirklichkeit hier nicht mehr hält.
Mit dieser zauberhaften Erfindung gelingt es Jens Wonneberger, die Beziehung zwischen Vater und Sohn, über der so viel Ungesagtes, Ungelöstes liegt, spielerisch zu poetisieren. Mit Lakonie bringt er dieses Museum der verlorenen Zeit sprachlich zum Klingen. Auch das Dorf jenseits der Familie bekommt seine Physiognomie. In meisterhaften Miniaturen haben die Absonderlichen ihren Auftritt, die auch die DDR nicht zu domestizieren vermochte: Schlendermax, der Dorftrottel, Birnstein, der Chrysanthemen- und Gurkenzüchter, oder Kretschel, der Kutscher, der einmal samt seinem Gespann in einem Schlammloch versank.
In „Himmelreich“ errettet Jens Wonneberger sie alle in eine deutsche Prosa, die zum Besten gehört, was derzeit geschrieben wird.
- Veröffentlicht am Montag 5. Oktober 2015 von Muery Salzmann
- ISBN: 9783990141281
- 160 Seiten
- Genre: Belletristik, Erzählende Literatur