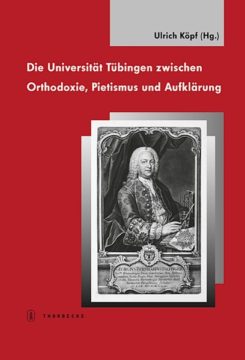Mit folgenden Beiträgen:
Vorwort des Herausgebers (Ulrich Köpf) – Einleitung (Sönke Lorenz) Tübingen. Stadt und Universität nach dem 30-jährigen Krieg (Wilfried Setzler) – Die Lehre an der Tübinger Theologischen Fakultät im Zeichen der Orthodoxie (Ulrich Köpf) – Christian Eberhard Weismann (1677-1747): Ein Tübinger Theologe zwischen Spätorthodoxie, radikalem Pietismus und Frühaufklärung (Joachim Weinhardt) – Christoph Matthäus Pfaff (1686-1760) als Tübinger Universitätskanzler und Professor (Wolf-Friedrich Schäufele) – Georg Bernhard Bilfinger zwischen Philosophie und Theologie (Reinhold Rieger) – Studium et Praxis Pietatis: Die Stellung von Universität und Evangelischem Stift Tübingen zum Pietismus in der Zeit zwischen 1662 und 1745 (Wolfgang Schöllkopf) – Die Tübinger juristische Fakultät zwischen 1650 und 1750 (Jan Schröder) – Die letzten Hexenprozesse in der Spruchpraxis der Juristischen Fakultät Tübingen: Neubewertung des Hexereidelikts im Spannungsfeld von Orthodoxie, Pietismus und Aufklärung? (Marianne Dillinger) – Rudolph Jakmerarius (1665-1721) und Johann Georg Gmelin (1709-1755) zwei hervorragende Vertreter der Tübinger Medizinischen Fakultät (Peter Dilg) – Der Rhetoriker und Poet Christoph Kaldenbach (1613-1698) (Friedrich Seck) – Die universitäre Berufungs- und Zensurpraxis im 18. Jahrhundert am Beispiel des Tübinger Professors Israel Gottlieb Canz (Bernhard Homa) – Mathematik und Naturlehre in Tübingen zwischen 1635 und 1740: Von Johann Jacob Hainlin bis zu Johann Conrad Creiling und seiner Schule (Gerhard Betsch) – Von Lasso über Schütz zu madrigalischen Kantaten und Mannheimer Sinfonien: Der Wandel des musikalischen Repertoires am Evangelischen Stift in Tübingen zwischen 1654 und 1767 (Joachim Kremer)
- Veröffentlicht am Freitag 14. November 2014 von Jan Thorbecke Verlag
- ISBN: 9783799555258
- 439 Seiten
- Genre: Geschichte, Ländergeschichte, Regionalgeschichte, Sachbücher